Vitamin E
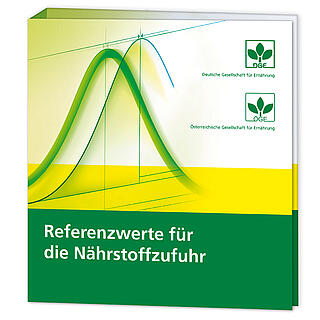
Die Antworten dieser FAQ stammen größtenteils aus den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr. Inhaltlich umfangreichere Erläuterungen inklusive der Ableitung der Referenzwerte sowie der Quellenangaben sind publiziert in:
Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Bonn, 3. Auflage, 1. Ausgabe (2025)
1. Was ist Vitamin E?
- Vitamin E gehört zu den fettlöslichen Vitaminen und wird nur von Pflanzen gebildet. Es muss daher mit der Nahrung zugeführt werden.
- Unter dem Begriff Vitamin E werden verschiedene Verbindungen, sogenannte Tocopherole, zusammengfasst. Abhängig von der chemischen Struktur kann zwischen α-, β-, γ- und δ-Tocopherol und den dazugehörigen Tocotrienolen unterschieden werden. Hauptvertreter mit dem höchsten Gehalt in Lebensmitteln sind α- und γ‑Tocopherol.
- Bisher wurde nur für α-Tocopherol nachgewiesen, dass es Vitamin-E-Mangelsymptomen vorbeugen bzw. diese beheben kann.
2. Wofür benötigt der Körper Vitamin E?
Vitamin E wirkt unspezifisch als primäres lipophiles Antioxidans, welches die Bildung bzw. Ausbreitung freier Radikale verhindert. Als Radikalfänger schützt Vitamin E insbesondere die Doppelbindungen der ungesättigten Fettsäuren, sowie DNA, Proteine, Lipide und Lipoproteine vor oxidativen Schäden. Zusammen mit anderen Antioxidantien, wie Vitamin C, trägt es damit zum Schutz biologischer Moleküle bei. Zudem ist Vitamin E wichtig für die Stabilität der roten Blutkörperchen (Erythrozyten) und des Nervensystems.
Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Vitamin E weitere Funktionen haben könnte, z. B. bei Entzündungsprozessen und im Immunsystem.
3. Welche Folgen hat ein Vitamin-E-Mangel?
Ein Vitamin-E-Mangel tritt beim Menschen nur sehr selten auf, da in der Regel ausreichend Vitamin E über die Ernährung zugeführt und im Fettgewebe gespeichert wird.
Bei bestimmten genetischen Erkrankungen, wie z. B. Mukoviszidose oder Abetalipoproteinämie) sowie bei Störungen der Fettverdauung, wie z. B. nach (teilweiser) Entfernung des Dünndarms, oder bei schwerwiegenden Lebererkrankungen konnten Mangelerscheinungen beobachtet werden. Die auftretenden Symptome sind eher unspezifisch, wie Störungen des Nervensystems, der Muskulatur und Krankheiten des Herzmuskels (Kardiomyopathie). Zudem kann es bedingt durch einen Vitamin-E-Mangel zu Verlust der Zellmembranstabilität kommen, welcher zu einer hämolytischen Anämie führen kann. Dies kommt gelegentlich bei Frühgeborenen beobachtet vor.
Ataxie (eine neurologische Störung) ist eine typische Mangelerscheinung, die bei einem isolierten Vitamin-E-Mangel durch einen genetischen Defekt auftritt.
4. Wie hoch sind die Referenzwerte für Vitamin E?
Für alle Personengruppen kann aufgrund der unzureichenden Daten aus Studien am Menschen kein durchschnittlicher Bedarf ermittlet werden, daher wird der Referenzwert für Vitamin E als Schätzwert für eine angemessene Zufuhr abgeleitet. Der Schätzwert für Kinder ab 1 Jahr, Jugendliche und Erwachsene sowie Schwangere liegt bei 8 mg/Tag Vitamin E (α-Tocopherol). Zum Ausgleich des Verlusts über die Frauenmilch erhöht sich der Schätzwert für Stillende auf 13 mg/Tag Vitamin E.
5. Die Referenzwerte wurden 2025 überarbeitet – was hat sich geändert?
Die neuen Referenzwertn für die Vitamin-E-Zufuhr beziehen sich nur noch auf α‑Tocopherol und nicht mehr auf Tocopheroläquivalente, bei denen die unterschiedliche biologische Aktivität der verschiedenen Vitamin-E-Formen (siehe Frage 1) berücksichtigt wurde. Da diese Daten aus Tierstudien stammen und die Übertragbarkeit auf den Menschen ist nicht zwingend gegeben, daher gilt die Umrechnung in Tocopheroläquivalente mittlerweile als überholt. Zudem ist bisher nur für α‑Tocopherol nachgewiesen, dass es einen Vitamin-E-Mangel beheben kann (siehe Frage 1).
Die Vorgehensweise der Ableitung hat sich ebenfalls geändert. Früher wurde der Schätzwert für eine angemessen Vitamin-E-Zufuhr anhand der für den Schutz der Doppelbindung der ungesättigten Fettsäuren aus Nahrung und im Körper benötigten Vitamin-E-Menge abgeleitet. Aufgrund der großen Schwankungen an ungesättigten Fettsäuren in der Nahrung und im Körper, sowie fehlender aussagekräftiger Biomarker des Vitamin-E-Status (siehe Frage 6) und fehlender Mangelsymptomatik (siehe Frage 3) erfolgt die Ableitung nun anhand der täglichen Verluste unter Berücksichtigung der Bioverfügbarkeit und eines Zuschlags für individuelle Schwankungen. Die so abgeleiteten Referenzwerte sind deutlich geringer als die bisher gültigen Schätzwerte (11–15 mg/Tag).
6. Wie kann die Vitamin-E-Versorgung beim Menschen bestimmt werden?
Eine genaue Beurteilung des Vitamin-E-Status beim Menschen ist aktuell leider nicht möglich, weil u. a. die Leber die Vitamin-E-Plasmakonzentration bei Überschuss durch einen vermehrten Abbau begrenzt, und außerdem eine Speicherung im Fettgewebe erfolgt.
Häufig wird die α‑Tocopherol-Konzentration im Plasma für die Beurteilung der Versorgung herangezogen. Allerdings wird dieser Parameter durch weitere Faktoren beeinflusst, wie bspw. die Konzentration der Blutlipide.
7. Welche Lebensmittel sind natürlicherweise reich an Vitamin E?
Die besten Vitamin-E-Lieferanten sind Nüsse, Samen und daraus hergestellte Pflanzenöle und Fette. Insbesondere Weizenkeim-, Sonnenblumen-, Maiskeim-, Raps-, Lein-, Oliven- und Sojaöl sowie Haselnüsse, Mandeln und daraus hergestellte Öle enthalten viel α-Tocopherol.
8. Wie kann der Referenzwert für eine angemessen Vitamin-E-Zufuhr erreicht werden?
Tabelle 1 zeigt drei Beispielrechnungen, wie durch eine gezielte Auswahl von Lebensmitteln mit einem hohen Vitamin-E-Gehalt eine Zufuhr in Höhe des Referenzwerts erreicht werden kann. Im ersten Beispiel wurde für die Berechnung der Referenzwert für Erwachsene mit 8 mg Vitamin E zurunde gelegt. In den beiden weiteren Beispielen wurde der höchste Referenzwert, 13 mg Vitamin E für Stillende, verwendet.
Bei den Beispielrechnungen ist zu beachten, dass es sich nicht um einen vollständigen Tagesplan handelt, sondern nur die Lebensmittel aufgeführt werden, die Vitamin E enthalten. Zudem ist zu beachten, dass der Referenzwert nicht täglich erreicht werden muss, sondern es ausreicht die Vorgaben im Durchschnitt einer Woche zu erfüllen (siehe FAQ Referenzwerte).
| Portionsgröße (verzehrbarer Anteil) | Lebensmittel | Vitamin-E-Gehalt in mg |
| Mischkost | ||
1 Portion (120 g) | Lachs | 3 |
1 Portion (25 g) | Mandeln | 6 |
| Summe Mischkost | 9 mg | |
| ovo-lacto-vegetarische Ernährung | ||
1 Stück (60 g) | Ei, gekocht | 6 |
1 Portion (110g) | Süßkartoffeln | 5,5 |
1 Portion (110 g) | Paprika | 2,8 |
| Summe ovo-lacot-vegetarische Ernährung | 14,3 mg | |
| vegane Ernährung | ||
Portion (10 g) | Weizenkeimöl | 15 |
| Summe vegane Ernährung | 15 mg | |
9. Kann zuviel Vitamin E schaden?
Vitamin E weist eine niedrige Toxizität auf. Dies ist auf eine geringere Speicherung in den Organen und einem vermehrten Abbau durch die Leber bei hoher Zufuhr von Vitamin E zurückzuführen. Im Rahmen einer gesundheitsfördernden und ökologisch nachhaltigen Ernährung mit üblichen Lebensmitteln ist eine Überversorgung mit Vitamin E nicht möglich.
Durch die Einnahme über Präparate kann es zu einer Überversorgung mit Vitamin E kommen. Hierbei wird eine erhöhte Blutungsneigung, sowie ein erhöhtes Risiko für Prostatakarzinom beobachtet. Aus diesem Grund gibt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für Erwachsene eine tägliche tolerierbare Gesamtzufuhr in Höhe von 300 mg Vitamin E (α-Tocopherol) an. Dieser Wert gilt nicht für Personen, die Medikamente zur Blutgerinnung (z. B. Aspirin) erhalten, mit Vitamin-K-Malabsorptionssyndromen oder zur Sekundärprävention von kardiovaskulären Erkrankungen. Auch für Personen mit spezifischen Erkrankungen, die einen Vitamin-E-Mangel verursachen, gelten keine Höchstmengen. Diese Bevölkerungsgruppen befinden sich in ärztlicher Behandlung, und daher sollte jede Supplementation von Vitamin E (α‑Tocopherol) unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
Quelle: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr
letzte Änderung: 10.09.2025