Jod
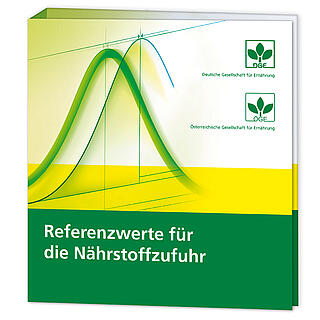
Die Antworten dieser FAQ stammen größtenteils aus den Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr. Inhaltlich umfangreichere Erläuterungen inklusive der Ableitung der Referenzwerte sowie der Quellenangaben sind publiziert in:
Deutsche Gesellschaft für Ernährung, Österreichische Gesellschaft für Ernährung (Hrsg.): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Bonn, 3. Auflage, 1. Ausgabe (2025)
1. Was ist Jod und wofür braucht der Körper es?
- Jod ist ein lebensnotwendiges Spurenelement, welches mit der Nahrung zugeführt werden muss.
- Jod ist ein wesentlicher Bestandteil der Schilddrüsenhormone T3 und T4 und bestimmt somit die Schilddrüsenfunktion während des gesamten Lebens.
- Schilddrüsenhormone sind an allen wichtigen Stoffwechselprozessen des Körpers, wie Energie-, Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel, sowie an der Thermogenese und der Knochenbildung beteiligt. Darüber hinaus sind sie für ein normales Wachstum sowie die neuronale Entwicklung unerlässlich.
2. Wie hoch ist die empfohlene Zufuhr für Jod?
Der Referenzwert für die Zufuhr von Jod ist altersabhängig. Für Säuglinge im Alter von 0 bis unter 12 Monaten liegt die empfohlene Zufuhr für Jod bei 80 µg/Tag, für Kinder bis unter 7 Jahren bei 90 µg/Tag und für bis unter 13 Jahren bei 120 µg/Tag. Ab einem Alter von 13 Jahren beträgt die empfohlene Zufuhr 150 µg/Tag. Schwangere und Stillende haben einen erhöhten Bedarf an Jod, daher steigt die empfohlene Zufuhr bei Schwangeren auf 220 µg/Tag und bei Stillenden auf 230 µg/Tag an.
3. Die Referenzwerte für die Jodzufuhr wurden 2025 überarbeitet - was hat sich geändert?
Der Referenzwert für die tägliche Jodzufuhr für Säuglinge hat sich von 40 µg auf 80 µg verdoppelt. Im Gegensatz zum alten Referenzwert, und wie sonst üblich für diese Altersgruppe, erfolgte die Ableitung nicht nur über den Jodgehalt in der Frauenmilch, sondern auch anhand neuer Daten aus Bilanzstudien. Dadurch war es möglich auch für Säuglinge einen durchschnittlichen Bedarf für Jod anzugeben und daraus den Referenzwert für die Jodzufuhr als empfohlene Zufuhr abzuleiten und nicht wie für diese Altersgruppe üblich einen Schätzwert.
Beim Referenzwert für die Erwachsenen hat sich an der Vorgehensweise der Ableitung nichts geändert. Jedoch wurde in der Vergangenheit Deutschland von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als mäßiges bis schweres Jodmangelgebiet eingestuft. Dies wurde bei der vorherigen Ableitung des Referenzwertes im Jahr 2000 zur Verbesserung der Jodversorgung der Bevölkerung in Deutschland und Österreich durch einen Zuschlag berücksichtigt. Dies entspricht nicht mehr dem wissenschaftlichen Vorgehen bei der Ableitung von Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr (siehe Frage 4).
Daher ergibt sich für die empfohlene Zufuhr bei Erwachsenen ein Wert von 150 µg/Tag Jod, welcher über den durchschnittlichen Bedarf aus Radiojod- und Bilanzstudien ermittelt wurde. Dieser Wert entspricht dem von der WHO vorgeschlagenen Referenzwert für die Jodzufuhr und dem bisherigen für die Schweiz, wo als Folge eines jahrzehntelangen Jodsalzprogramms die Versorgung bereits besser als in Deutschland und Österreich war.
4. Warum wurde bei der Ableitung des Referenzwerts nicht berücksichtigt, dass ein Teil der Bevölkerung nicht ausreichend mit Jod versorgt ist?
Die Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr gelten für Gesunde. Sie beziehen sich nicht auf die Versorgung von Kranken und Rekonvaleszenten oder bei Nährstoffmangel (siehe FAQ zu Referenzwerten allgemein). In diesen Fällen ist eine individuelle Zufuhr des jeweiligen Nährstoffes zu beachten.
In der Vergangenheit wurde Deutschland von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als mäßiges bis schweres Jodmangelgebiet eingestuft. Dies wurde bei der vorherigen Ableitung des Referenzwertes im Jahr 2000 berücksichtigt. Aus diesem Grund wurde mit dem Ziel die Jodversorgung der Bevölkerung in Deutschland und Österreich zu verbessern, ein Zuschlag berücksichtigt. Dies entspricht, wie oben erläutert, nicht mehr dem wissenschaftlichen Vorgehen bei der Ableitung von Referenzwerten für die Nährstoffzufuhr. Die Grundlage für den Referenzwert für die Jodzufuhr erfolgt über den aus Studien ermittelten durchschnittlichen Bedarf (siehe Frage 3).
5. Welche Lebensmittel sind (natürlicherweise) reich an Jod?
Natürlicherweise sind nur marine Lebensmittel, wie Seefisch, Meeresfrüchte und Algen reich an Jod. Bei entsprechender Fütterung der Tiere können auch Milch und Milchprodukte sowie Eier eine gute Jodquelle sein (siehe Frage 7).
Da die Böden in Deutschland jodarm sind, ist der Gehalt in pflanzlichen Lebensmitteln natürlicherweise sehr gering.
Eine wichtige Jodquelle stellt jodiertes Speisesalz und damit hergestellte Lebensmittel dar (siehe Frage 17).
6. Wie kann der Referenzwert für die Jodzufuhr erreicht werden?
Tabelle 1 zeigt Beispielrechnungen wie durch die gezielte Auswahl von Lebensmitteln mit einem hohen Jodgehalt eine Zufuhr in Höhe des Referenzwerts von 150 µg/Tag für Erwachsene erreicht werden kann.
Bei den Beispielrechnungen ist zu beachten, dass es sich nicht um einen vollständigen Tagesplan handelt, sondern nur die Lebensmittel aufgeführt werden, die Jod enthalten. Zudem ist zu beachten, dass der Referenzwert nicht täglich erreicht werden muss, sondern es ausreicht die Vorgaben im Durchschnitt einer Woche zu erfüllen (siehe FAQ zu Referenzwerten allgemein).
| Portionsgröße (verzehrbarer Anteil) | Lebensmittel | Jod in µg pro Portion |
| Mischkost | ||
| Portion (120 g) | Kabeljau | 330 |
| Summe Mischkost | 330 | |
| Mischkost | ||
| 1 Portion (120 g) | Seelachs | 94 |
| 1 Portion (30 g) | Bergkäse | 25 |
| 1 Portion (2 g) | Jodiertes Speisesalz zur Zubereitung | 40 |
| Summe Mischkost | 159 | |
| ovo-lacto-vegetarische Ernährung | ||
| 1 Portion (250 ml) | Milch aus biologischer Landwirtschaft | 15 |
| 1 Portion (100 g) | Mozzarella | 100 |
| 1 Portion (2 g) | Jodiertes Speisesalz zur Zubereitung | 40 |
| Summe ovo-lacto-vegetarische Ernährung | 155 | |
| ovo-lacto-vegetarische Ernährung | ||
| Portion (30 g) | Mascarpone | 54 |
| 1 Portion (250 ml) | Milch aus konventioneller Landwirtschaft | 30 |
| 1 Portion (30 g) | Schafskäse | 23 |
| 1 Stück (60 g) | Ei, gekocht | 9 |
| 1 Portion (2 g) | Jodiertes Speisesalz zur Zubereitung | 40 |
| Summe | 156 | |
7. Warum sind Milch, Milchprodukte und Eier Jodlieferanten?
Auch Tiere benötigen Jod für ihre Gesundheit. Aus diesem Grund ist es erlaubt Tierfutter mit Jod anzureichern. Dieses Jod wird in die Milch und Eier der Tiere abgegeben, Fleisch hingegen enthält nur relativ wenig Jod. Der Gehalt an Jod im Tierfutter unterliegt zum Verbraucherschutz gesetzlichen Höchstmengen, bspw. ist bei Kraftfutter für Kühe eine Anreicherung mit Jod bis max. 5 mg/kg erlaubt.
Durch unterschiedliche Fütterungsmethoden (Weide- oder Stallhaltung, Anteil und Art des Kraftfutters, Bereitstellung von Jodsalz) kann es zu erheblichen Schwankungen im Jodgehalt von Milch und Milchprodukten kommen. Milch aus ökologischer Landwirtschaft enthält durch Unterschiede in der Fütterung häufig weniger Jod als Kuhmilch aus konventioneller Landwirtschaft. Auch die Verwendung von jodhaltigen Mitteln zur Desinfektion der Euter oder der Geräte kann den Jodgehalt der Kuhmilch erhöhen.
Milch und Milchprodukte sind, insbesondere für Kinder, eine wichtige Jodquelle, sie tragen wesentlich zur Jodzufuhr bei.
8. Wie hoch ist die Jodzufuhr in Deutschland und wie ist der Versorgungstatus der deutschen Bevölkerung?
Daten der KiESEL-Studie (Kinder-Ernährungsstudie zur Erfassung des Lebensmittelverzehrs) zeigen, dass 45 % der Mädchen und 37 % der Jungen im Alter von 1 bis 2 Jahren eine Jodzufuhr unterhalb des durchschnittlichen Bedarfs aufweisen und Jod ein kritischer Nährstoff für diese Altersgruppe ist.
Berechnungen der täglichen Jodzufuhr anhand der Jodausscheidung im Urin (siehe Frage 10) zeigen für Kinder eine mediane Gesamtjodzufuhr von 65 µg/Tag (3‑6 Jahre), 76 µg/Tag (7-10 Jahre), 88 µg/Tag (11-13 Jahre) und 101 µg/Tag (14-17 Jahre) und für die erwachsenen Bevölkerung von 126 µg/Tag. Dabei zeigen Jungen eine höhere Jodzufuhr als Mädchen. Insgesamt weisen in Deutschland ca. 32 % der Erwachsenen und ca. 44 % der Kinder und Jugendlichen eine Jodzufuhr unterhalb des von der WHO geschätzten mittleren Bedarfs auf. Deutschland wird als mildes Jodmangelgebiet eingestuft (siehe Frage 12).
9. Wie kann eine ausreichende Jodversorgung sichergestellt werden?
Der regelmäßige Verzehr von marinen Lebensmitteln, wie Seefisch und Meeresfrüchten, sowie von Milch und Milchprodukten und insbesondere die regelmäßige Verwendung von jodiertem Speisesalz und damit hergestellten Lebensmitteln tragen maßgeblich zu einer adäquaten Jodversorgung bei (siehe Frage 5).
Beim Verzehr pflanzlicher Milchalternativen anstelle von Kuhmilch ist darauf zu achten, dass diese mit Jod angereichert sind oder auf andere Jodquellen zurückgegriffen wird.
Auch der Verzehr von Algen mit deklariertem Jodgehalt kann zur Jodversorgung beitragen. Allerdings schwankt der Jodgehalt in Algen stark, was möglicherweise ein Risiko für eine Überversorgung darstellen kann (siehe Frage 20).
Ist eine ausreichende Jodversorgung über die Ernährung nicht gewährleistet sollte in ärztlicher Absprache ein Jodpräparat verwendet werden.
10. Wie kann der Versorgungstatus mit Jod beurteilt werden?
Die Beurteilung der Jodversorgung auf Bevölkerungsebene erfolgt über die Jodausscheidung im Urin. Denn etwa 90 % des täglich aufgenommenen Jods wird innerhalb von 24 Stunden nach dem Verzehr mit dem Urin ausgeschieden. Daher wird angenommen, dass die Urinkonzentration die Jodzufuhr widerspiegelt und zur Schätzung der Jodzufuhr verwendet werden kann. Die Schätzung erfolgt anhand einer mathematischen Formel, welche auch Faktoren wie Körpergewicht, Alter und Geschlecht berücksichtigt. Zur Beurteilung der Jodversorgung werden Kriterien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herangezogen. Eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung liegt laut diesen WHO-Kriterien bei einer medianen Jodkonzentration im Urin zwischen 100 und 199 µg/l vor.
Die individuelle Jodzufuhr ist jedoch von Tag zu Tag sehr unterschiedlich, zudem ist die Urinkonzentration von verschiedenen Einflussfaktoren wie bspw. der Trinkmenge abhängig. Demzufolge ist die Urinkonzentration nicht geeignet, um die individuelle Jodzufuhr zu bewerten oder einen Jodmangel bei Einzelpersonen zu diagnostizieren.
11. Warum kann die Jodversorgung nicht anhand von Zufuhrdaten aus Ernährungserhebungen bzw. mittels Ernährungsprotokollen beurteilt werden?
Ernährungserhebungen sind aus verschiedenen Gründen zur Erfassung der Jodzufuhr ungeeignet, bspw. lässt sich die Menge des verwendeten jodierten Speisesalzes bei der Speisezubereitung oder während des Zusalzens am Tisch nicht zuverlässig bestimmen.
Zudem variiert der Jodgehalt in den Lebensmitteln erheblich, insbesondere in Abhängigkeit der Verwendung von jodiertem Speisesalz in verarbeiteten Lebensmitteln und in tierischen Lebensmitteln durch die uneinheitliche Verwendung von jodierten Futtermitteln. Diese Schwankungen werden in Nährwertdatenbanken nicht erfasst.
12. Warum ist die Jodversorgung wieder rückläufig?
Seit Mitte der 1980er Jahre konnte durch verschiedene Maßnahmen, wie die Verwendung von jodiertem Speisesalz in privaten Haushalten, in der Lebensmittelproduktion und der Außer-Haus-Verpflegung sowie die Jodanreicherung von Futtermitteln, die Jodversorgung der Bevölkerung auch in Deutschland und Österreich verbessert werden.
Die nun beobachtete rückläufige Versorgung der Bevölkerung mit Jod hat verschiedene Gründe. So ist bspw. der Verwendungsgrad von jodiertem Speisesalz in verarbeiteten Lebensmitteln rückläufig und liegt mittlerweile bei unter 30 %. Auch der Anstieg des Konsums von biologisch erzeugten Lebensmitteln trägt zu einer Verschlechterung der Jodversorgung bei. Denn bei der Herstellung von Bio-Lebensmitteln wird deutlich seltener jodiertes Speisesalz eingesetzt, beispielsweise bei Brotwaren. Auch der Einsatz von Futtermitteln mit Jodzusatz ist in der ökologischen Landwirtschaft geringer als in der konventionellen.
Zudem wird ein steigender Konsum an pflanzlichen Alternativprodukten tierischer Lebensmittel beobachtet. Diese enthalten häufig wenig Jod, da in der Herstellung selten jodiertes Speisesalz eingesetzt wird. Kritisch für die Jodversorgung ist auch der steigende Konsum pflanzlicher Milchalternativen, da diese selten mit Jod angereichert sind. Milch und Milchprodukte tragen aber wesentlich zur Jodversorgung bei (siehe Frage 7 und FAQ zu pflanzlichen Milchalternativen).
13. Was sind die Symptome und Folgen eines Jodmangels?
Jodmangel kann die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen. Leichter Jodmangel führt zu einer chronischen Überstimulation der Schilddrüse. In Bevölkerungsgruppen, die einem leichten Jodmangel ausgesetzt sind, treten häufiger Schilddrüsenvergrößerungen (Struma, Kropf), Schilddrüsenknoten und Hyperthyreosen (Schilddrüsenüberfunktion) auf, insbesondere bei Erwachsenen und älteren Menschen. Eine unbehandelte Hyperthyreose erhöht das Risiko von Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz und Osteoporose sowie von kognitiven Beeinträchtigungen bei älteren Menschen.
Ein längerer Jodmangel kann zur Entwicklung einer Struma und einer subklinischen Hypothyreose führen. Bei Erwachsenen sind die Symptome der Hypothyreose (Schilddrüsenunterfunktion) unspezifisch und umfassen u. a. leichte bis mäßige Gewichtszunahme, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, langsamen Puls, trockene Haut, Haarausfall, Depressionen und bei Frauen Störungen des Menstruationszyklus.
Ein schwerer Jodmangel während der Schwangerschaft kann Auswirkung auf die neurologische Entwicklung des Kindes haben, dies kann zu Kretinismus, neurologischen und kognitiven Defiziten, einschließlich eines verringerten Intelligenzquotienten führen. Daher ist bereits vor der Schwangerschaft auf eine adäquate Jodversorgung zu achten. Nach der Geburt beeinträchtigt eine Hypothyreose die Entwicklung des kindlichen Kleinhirns, einschließlich der sprachlichen Fähigkeiten.
14. Warum ist eine ausreichende Versorgung mit Selen, Vitamin A und Eisen im Zusammenhang mit Jod ebenfalls wichtig?
Selen, Eisen und Vitamin A sind, wie Jod, an der Synthese und dem Metabolismus von Schilddrüsenhormonen beteiligt. Ein Selen-, Eisen- und/oder Vitamin-A-Mangel kann daher bei einem gleichzeitigen Jodmangel die negativen Folgen des Jodmangels potenziell verschärfen.
15. Welche Personen haben ein erhöhtes Risiko für einen Jodmangel?
Jod gilt als kritischer Nährstoff in der Allgemeinbevölkerung. Die Versorgung der Bevölkerung ist teils unzureichend und Deutschland wird von WHO als mildes Jodmangelgebiet ausgewiesen (siehe Frage 8).
Da Jod für Wachstum und Entwicklung benötigt wird (siehe Frage 1), ist eine unzureichende Jodversorgung besonders kritisch bei schwangeren oder stillenden Frauen, Säuglingen und Kleinkindern, sowie Kindern und Jugendlichen (siehe Frage 13).
Da Schwangere und Stillende zudem einen erhöhten Jodbedarf haben, wird ihnen für eine adäquate Jodversorgung die Einnahme eines Präparates empfohlen (siehe Frage 16).
Insbesondere ist das Risiko einer unzureichenden Jodversorgung bei veganer Ernährung erhöht (siehe FAQ zu veganer Ernährung).
16. Warum wird die Einnahme von Jod-Präparaten in der Schwangerschaft und Stillzeit empfohlen?
Schwangere und Stillende haben einen wesentlich erhöhten Jodbedarf und eine unzureichende Versorgung mit Jod kann negative Folgen für die (kognitive) Entwicklung des Kindes haben (siehe Frage 13). Daher sollten Schwangere und Stillenden zusätzlich zu einer ausgewogenen Ernährung mit jodiertem Speisesalz täglich ein Supplement mit einer Dosis von 100 (bis 150) µg Jod einnehmen. Bei Schilddrüsenerkrankungen sollte vor der Supplementierung eine ärztliche Rücksprache erfolgen. Bereits bei Kinderwunsch ist auf eine ausreichende Jodversorgung zu achten.
17. Warum ist die Verwendung von jodiertem Speisesalz so wichtig?
Im Allgemeinen ist die Ernährung arm an nativem Jod (siehe Frage 5), sodass der Jodbedarf ohne die Verwendung von jodiertem Speisesalz nur schwer gedeckt werden kann. Um einen Jodmangel zur vermeiden, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) daher die universelle Verwendung von jodiertem Speisesalz im Haushalt und in verarbeiteten Lebensmitteln. Die Anreicherung von Speisesalz mit Jod stellt eine äußerst kosteneffiziente Public-Health-Maßnahme dar, um einem Jodmangel in der Bevölkerung entgegenzuwirken.
„Wenn Salz, dann Jodsalz“ ist die Informationsoffensive des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat zur Aufklärung zur Bedeutung von Jodsalz.
18. Kann die Verwendung von jodiertem Speisesalz zu einer Überversorgung und damit zu gesundheitlichen Problemen führen?
Nein, selbst wenn die Gesamtzufuhr an Speisesalz jodiert wäre, zeigen Modellrechnungen, dass eine Überschreitung der tolerierbaren Gesamtzufuhrmenge (siehe Frage 19) unwahrscheinlich ist. Der Jodgehalt in jodiertem Speisesalz ist gesetzlich geregelt und liegt in Deutschland bei 15 bis 25 mg/kg Salz. Diese Werte sind an die heutige Salzzufuhr angepasst und selbst ein hoher Salzkonsum stellt kein Risiko für eine Überversorgung mit Jod dar.
19. Kann zu viel Jod schaden?
Eine übermäßige Jodzufuhr führt nicht grundsätzlich zu einer Schilddrüsenfehlfunktion. Eine gesunde Schilddrüse ist in der Lage hohe Jodmengen homöostatisch zu regulieren und sich daran anzupassen. Wenn diese Anpassung der Schilddrüse fehlschlägt, besteht das Risiko eines erhöhten Schilddrüsenvolumens, einer Hypothyreose oder Hyperthyreose, sowie ein erhöhtes Risiko für die Entstehung einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse.
Gemäß der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) stellt die langfristige Zufuhr von maximal 600 μg/Tag Jod kein gesundheitliches Risiko für Erwachsene dar. Für Kinder wurden altersabhängig entsprechend niedrigere maximale Gesamtzufuhrmengen (tolerable upper intake levels, ULs) abgeleitet: für 1- bis 3-Jährige 200 μg/Tag, für 4- bis 6-Jährige 250 μg/Tag, für 7- bis 10-Jährige 300 μg/Tag, für 11- bis 14-Jährige 450 μg/Tag und für 15- bis 17-Jährige 500 μg/Tag.
Das Risiko einer übermäßigen Jodzufuhr über die Ernährung ist, auch bei Verwendung von jodiertem Speisesalz, gering. Eine übermäßige Jodzufuhr kann durch den Verzehr von jodreichen Algen (siehe Frage 20) oder hochdosierte Nahrungsergänzungsmittel entstehen.
20. Algen für die Jodversorgung – was ist zu beachten?
Getrockneten Meeresalgen und Seetangprodukten können besonders viel Jod enthalten, da sie das im Meerwasser enthaltene Jod aufnehmen und zum Teil stark anreichern. Der Jodgehalt in den Algen schwankt erheblich, besonders jodreich sind Braunalgen, wie Kombu und Wakame. Schon bei geringen Verzehrmengen (bis 10 g) kann es bereits zu einer exzessiven Jodzufuhr kommen, welche zu teilweise schweren Gesundheitsschäden führen kann. Aus diesem Grund stuft das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) getrocknete Algenprodukte mit einem Jodgehalt von > 20 mg/kg als gesundheitsschädlich ein und rät vom Verzehr ab. Um gesundheitlich bedenkliche Jodmengen durch Meeresalgen zu vermeiden, sind bei diesen Algen Hinweise erforderlich, dass eine übermäßige Zufuhr von Jod zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen kann. Des Weiteren sollten Angaben zum Jodgehalt und zur maximalen Verzehrmenge aufgeführt werden. Beim Kauf von Meeresalgen sollte auf diese Hinweise auf dem Etikett geachtet werden.
Quelle: Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr
letzte Änderung: 15.09.2025